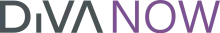Effektive Bedarfsermittlung: Methoden und ihre Anwendung erklärt.
- Marc Lange
- Logistik & Warenwirtschaft
Jedes Unternehmen, das Waren produziert und Material für die Herstellung der Endprodukte benötigt, muss sich mit Bedarfsmengen auseinandersetzen. Wie hoch sind die jeweiligen Materialbedarfe und welcher Bedarf an Produkten, Ersatzteilen und verkaufsfähigen Zwischenerzeugnissen kommt in Zukunft auf Dich zu? Hierbei ist Genauigkeit gefragt, damit Produktionen nicht zum Erliegen kommen.
Die Lösung liegt in der Bedarfsermittlung, für die auch verschiedene mathematisch-statistische Verfahren zum Einsatz kommen. Welche Bedarfsarten notwendig und sinnvoll sind, welche Methoden der Bedarfsermittlung es gibt und wie Du diese in der Praxis einsetzt? Wir geben wichtige Definitionen und klären diese Fragen in unserem Artikel.
Das Wichtigste auf einen Blick:
Mit einer Bedarfsermittlung stellst Du sicher, dass Du immer die richtige Menge an Teilen und Material bestellst. Dadurch vermeidest Du eine Unter- sowie eine Überversorgung.
Du kannst verschiedene Arten an Bedarf unterscheiden. Dazu gehört der Primär-, der Sekundär-, der Tertiär-, der Brutto- sowie der Nettobedarf.
Für die Bedarfsermittlung stehen verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung. Zu den wichtigsten zählen die programmorientierte sowie die verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung.
Mit einem ERP-System wie DiVA NOW kannst Du die Bedarfsplanung und die Materialwirtschaft optimieren.
Was ist eine Bedarfsermittlung?
Eine Bedarfsermittlung ist per Definition ein betriebswirtschaftliches Verfahren, das Firmen zur Ermittlung von Bedarfen durchführen. In der Materialwirtschaft zählt die Bedarfsermittlung zu den wichtigsten Methoden, da sie die Versorgung des Unternehmens mit Material sicherstellt und ermittelt, welche Materialbedarfe in Zukunft auftreten. Laut Definition wird die Bedarfsermittlung auch Bedarfsmengenplanung, Materialbedarfsplanung und Beschaffungsdisposition genannt.
Warum ist die Bedarfsermittlung für Unternehmen so wichtig?
Weil sie dabei hilft, Kosten sowie Lagerflächen zu optimieren. Bei der Materialbeschaffung ist nämlich Genauigkeit gefragt, um sowohl Über- als auch Unterversorgung zu vermeiden. Dies gilt sowohl bei Waren als auch bei Ersatzteilen, verkaufsfähigen Zwischenerzeugnissen bzw. Baugruppen und Fertigungsmaterial. Anders gesagt: Die Ermittlung des Bedarfs ist die Grundlage für sämtliche Beschaffungsstrategien.
Nicht nur die Beschaffung profitiert von der Analyse, sondern auch die Produktion. Welche Rohstoffe, halbfertige Erzeugnisse, Baugruppen und Einzelteile benötigst Du, um Aufträge fertigzustellen oder die Produktion am Laufen zu halten?
Ein Beispiel: Eine Firma produziert Gartenbänke aus Holz. Dann macht es durchaus einen Unterschied, ob sich ein Bedarf an 2 Tonnen Holz, 12.000 Schrauben und 30 Liter Öl ergeben, oder ob Du nur 1 Tonne Holz und 4.000 Schrauben benötigst. Eine Bestellung mit 4 Tonnen Holz und 16.000 Schrauben wäre nämlich eine Überbestellung, welche Lagerkosten verursacht und Kapital bindet. Eine zu niedrige Bestellung verursacht hingegen Lieferengpässe.
Bedarfsermittlung: Untergliederung gemäß nachstehender Bedarfsarten.
Bevor es an die Methoden zur Bedarfsermittlung geht, ist zunächst eine Untergliederung gemäß nachstehender Bedarfsarten notwendig:
Primärbedarf: Beim Primärbedarf handelt es sich um Endprodukte und Dienstleistungen, die Du direkt an die Kunden verkaufst. Dazu zählen beispielsweise fertige Autos, Schlafanzüge, Ersatzteile oder Holzbänke.
Sekundärbedarf: Hier drunter fallen alle Rohstoffe und Teile, welche für die Herstellung des Primärbedarfs oder fester Kundenaufträge nötig sind. Beispielsweise Autoreifen oder Windschutzscheiben fürs Auto, Knöpfe für Schlafanzüge sowie Holzlatten für die Holzbank.
Tertiärbedarf: Diese Materialien fließen zwar nicht direkt in das Endprodukt bzw. in den Primärbedarf ein, Du benötigst diese jedoch zur Produktion des Produktes. Es handelt sich hierbei um Betriebs- sowie um Hilfsmittel (z. B. Schmierstoffe für Maschinen).
Diese Unterscheidung in Primär-, Sekundär- und Tertiärbedarf richtet sich danach, was Du an Material im jeweiligen Produktionsschritt benötigst. Zusätzlich dazu kannst Du zwischen zwei weiteren Bedarfsarten unterscheiden:
Bruttobedarf: Dieser Wert ergibt sich, wenn Du Sekundärbedarf und Tertiärbedarf zusammenzählst. Es handelt sich also um den Gesamtbedarf, den Du für die Herstellung des Produktes benötigst.
Nettobedarf: Bei diesem handelt es sich hingegen um Material, welches Du noch durch Einkauf oder Fertigung zur Verfügung stellen musst. Der Wert ergibt sich, wenn Du vom Bruttobedarf den verfügbaren Bestand abziehst.
Verfügbarer Lagerbestand = | +Bestand -Reserviertes Material +Offene Bestellungen und Fertigungsaufträge -Sicherheitsbestand |
Nettobedarf= | Bruttobedarf – verfügbarer Bestand |

Übersicht: Methoden der Bedarfsermittlung.
Unter den Methoden der Bedarfsermittlung gibt es verschiedene Verfahren, die zum Einsatz kommen. Neben Schätzungen kannst Du beispielsweise einige Werte direkt einer ERP-Software entnehmen. Zudem kommen verschiedene mathematisch-statistische Verfahren zum Einsatz. Für die Bedarfsermittlung stehen folgende Methoden zur Verfügung:
1. Programmorientierte Bedarfsermittlung (deterministische Methode).
Diese Methode basiert auf aktuellen Produktionsplänen und Stücklisten. Den Primärbedarf ermitteln vorliegende Aufträge und Pläne. Mit deren Hilfe kannst Du dann den Sekundär- und Tertiärbedarf planen, benötigte Hilfs- und Betriebsmittel errechnen sowie den Brutto- und Nettobedarf ermitteln.
2. Verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung (stochastische Bedarfsermittlung).
Bei der verbrauchsorientierten (stochastischen) Methode erfolgt die Ermittlung des künftigen Bedarfs analog der zurückliegenden benötigten Menge.
Ein Beispiel? Für den Juli und August berechnet das Verfahren eine Menge aufgrund des vorherigen Verbrauchs und möglicher Prognosen. Es kommen mathematisch statistische Verfahren (Stochastik) zur Anwendung, mit welchen Du die Ergebnisse optimieren kannst. Bei schwankenden Absätzen sind diese besonders nützlich.
Ausschlaggebend sind die Bedarfsverläufe, welche konstant, trendförmig, saisonal, sporadisch oder stark schwankend sein können.
3. Regelbasierte Bedarfsermittlung.
Einfach erklärt, handelt es sich bei der regelbasierten Bedarfsermittlung um eine Wenn-Dann-Konstellation. Tritt ein bestimmter Fall ein, ergibt sich eine besondere Materialanforderung. Bestellt ein Kunde etwa ein Auto mit einer speziellen Ausstattung, ergibt sich ein Bedarf an konkreten Teilen und Hilfsmitteln (z. B. Leder in außergewöhnlicher Farbe, Bordcomputer usw.).
4. Subjektive Schätzung (heuristische Bedarfsermittlung).
Liegen nur wenige historische Daten vor, kannst Du den erwarteten Bedarf schätzen. Die Schätzung sollte dann auf Erfahrungswerten und auf einer gewissen Expertise basieren. Von dieser Methode ist jedoch abzuraten, wenn eine andere Methode besser für die Bedarfsermittlung geeignet ist.
Vor- und Nachteile der Methoden zur Bedarfsermittlung.
Jede der Methoden birgt eigene Vor- und Nachteile, die Du abwägen solltest. Nachfolgend haben wir Dir daher eine Übersicht mit den wichtigsten Argumenten zusammengestellt.
Methode | Vorteile | Nachteile |
Programmorientierte Bedarfsermittlung |
|
|
Verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung |
|
|
Regelbasierte Bedarfsermittlung |
|
|
Subjektive Schätzung |
|
|
Bedenke jedoch, dass die Methoden sich bei einigen Produktarten und Warengruppen besonders positiv oder negativ auswirken. So bietet sich die programmorientierte Bedarfsermittlung beispielsweise bei Spezialprodukten an, während die verbrauchsorientierte Bedarfsermittlung besonders für Massenfertigungen geeignet ist.

Bedarfsermittlung in der Praxis.
Bei der Anwendung der Bedarfsermittlung solltest Du in der Praxis zusätzliche Vorkehrungen treffen und die Entwicklung überwachen. Dazu kannst Du auf weitere Methoden setzen, die wir nachfolgend kurz vorstellen.
ABC-Analyse für die Bedarfsermittlung.
In der Regel weist das Lager eine begrenzte Kapazität auf. Daher ist es nicht immer möglich, tatsächlich die optimale Menge an Waren für alle Endprodukte zu lagern. Hier kommt die ABC-Analyse ins Spiel, die Dir hilft, Prioritäten zu setzen und festzulegen, für welche Waren Du die Bedarfsermittlung optimieren solltest.
Vereinfacht gesagt, teilst Du Deine Produkte in drei Kategorien ein:
A-Produkte: Diese sind besonders umsatzstark und haben eine hohe Priorität
B-Produkte: Diese tragen mittelmäßig zum Umsatz bei und haben nur eine mittlere Priorität
C-Produkte: Hierbei handelt es sich um umsatzschwache Artikel, die daher eine niedrige Priorität besitzen
Konzentriere Dich auf Produkte der A-Kategorie und optimiere für diese die Bedarfsermittlung.
SOLL-/IST-Verfahren.
Das SOLL-/IST-Verfahren hilft Dir hingegen abzugleichen, ob aktuelle Werte mit den Planwerten übereinstimmen. Dieses Vorgehen ist besonders bei rollierenden Planungen sinnvoll, damit Du den Materialfluss steuern und anpassen kannst. Wie viel ist etwa tatsächlich verfügbar vom Bedarf (Bruttobedarf) und wie ist die aktuelle Lieferbereitschaft? Du kannst Abweichungen bei der Bedarfsplanung schnell feststellen und Lieferengpässe oder Produktionsstillstände verhindern.
Anwendungsbeispiele zur Bedarfsermittlung.
Nun noch ein Beispiel aus der Praxis, welches die Bedarfsermittlung verdeutlicht.
Beispiel: Eine Firma fertigt Schlafanzüge. Für die Planperiode rechnet sie mit 100 Schlafanzügen.
| Erklärung | Materialmenge |
Primärbedarf | Der Schlafanzug ist das Endprodukt |
|
Sekundärbedarf | Für die Fertigung von einem Schlafanzug benötigen Sie:
|
|
Tertiärbedarf | Als Hilfsmittel kommen 10ml Schmiermittel pro Schlafanzug in die Nähmaschine. |
|
Bruttobedarf | Sekundärbedarf + Tertiärbedarf |
|
Nettobedarf | Bruttobedarf – verfügbarer Lagerbestand
Verfügbarer Lagerbestand:
|
|
Um der Planperiode zu entsprechen, muss der Betrieb die Mittel im Nettobedarf einkaufen.
Bedarfsermittlung mit DiVA NOW ERP vereinfachen.
Leistungsfähige ERP-Systeme wie DiVA NOW helfen Dir, Deine Materialwirtschaft zu vereinfachen und die Materialplanung zu optimieren. DiVA NOW bringt Transparenz in Deine Bestände, damit Du jederzeit Deinen Primär-, Sekundär- und Tertiärbedarf kennst. Für die Bedarfsermittlung nutzt Du sowohl historische Daten als auch Prognosen.
Dein Vorteil? Mit DiVA NOW wickelst Du die Bedarfsermittlung effektiv ab – ohne Über- oder Unterversorgung. Prozesse laufen flüssig und effizient, und Du kannst Aufträge termingerecht erfüllen.
Willst Du auch von DiVA NOW profitieren? Dann vereinbare noch heute einen Termin – wir entwickeln gemeinsam eine passgenaue Lösung für Dich!
Kontaktiere uns jetzt und starte den Weg zur smarten Materialplanung!
Weitere Beiträge zum Thema Logistik & Warenwirtschaft
In diesem Artikel erfährst Du:
Du hast Fragen zum Thema?
Du willst mehr über DiVA NOW erfahren oder hast eine konkrete Frage zum Thema? Dann melde Dich direkt bei Leo – er meldet sich schnellstmöglich zurück.
Preise
Transparente Pakete, klare Strukturen – unser Preismodell ist auf die Bedürfnisse von Start-Ups und KMU im E-Commerce zugeschnitten.
KMU und Startups
DiVA NOW ist genau richtig für alle, die im digitalen Handel schnell skalieren wollen – egal ob frisch gegründet oder schon etabliert.
Kontakt
Du hast Fragen oder möchtest direkt loslegen? Wir sind für Dich da – persönlich, unkompliziert und auf Augenhöhe.